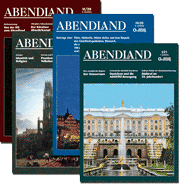Präsidentschaftskandidat Donald Trump – ein neues Kapitel in der amerikanischen Demokratie
Brief aus Amerika
Ende November machte ich auf dem Portal der „Blauen Narzisse“ eine leicht versteckte Voraussage bezüglich des schlagzeilenträchtigen Politikers Donald Trump. Nach meiner damaligen Schätzung sollte Trumps Neigung, „aus dem Stegreif zu reden“ und seine Konkurrenten in der Republikanischen Partei hart anzugehen, ihm schließlich schaden. Seine „Trumpfkarte“ (man verzeihe das mißlungene Wortspiel!) dürfte zu seinem Nachteil ausschlagen, besonders wenn er seinen Jähzorn nicht zügelt und wenn er nicht willens ist, seine Sozial- und Wirtschaftspolitik im einzelnen zu erläutern. Meine Ratschläge hat der republikanische Spitzenkandidat offenbar nicht befolgt und die kritisierten Gewohnheiten kaum abgestellt. Dennoch gelingt es ihm, einen Teil des republikanischen Establishment gezwungenermaßen auf seine Seite zu ziehen. Schon vor den bevorstehenden Vorwahlen in allen amerikanischen Bundesstaaten erweckte der Milliardär aus New York, der bis vor ein paar Jahren als „liberal democrat“ firmierte, den Eindruck, daß sein Wahlsieg „beinahe unentrinnbar“ sei. Immer mehr findet sich die in einen Engpaß geratene, die Partei bestimmende Schicht mit seiner Unentrinnbarkeit ab. Darunter sind auch Mitarbeiter der Republikaner, die bis vor kurzem alles Mögliche versuchten, um Trump die Nominierung zu versagen, doch mit ihrem Einfluß sind sie bereits am Ende.
Von Prof. Paul Gottfried
Dieser durch das Raster fallende Kandidat finanziert seinen eigenen Wahlkampf. Noch auffallender und in anderen Zeiten sicher als Nachteile empfunden, sind seine Prahlerei, seine nassforsche und besserwisserische Art, seine Weigerung, sich bezähmen zu lassen. Heute wirken sie sich jedoch zu Trumps Vorteil aus. Auf der Rednertribüne kommen ihm diese Eigenschaften zugute. Trump stellt sich als volksnah und offen dar. Im Gegensatz zu „den anderen“ ist er freimütig und tritt bei seinen Versammlungen mit „eigenen Worten“ auf. Zu den republikanischen Stiftungen, deren Konzepte und Stichworte sich seine innerparteilichen Gegner zunutze machen, steht Trump in keinerlei Beziehung. Allerdings bezeugt es auch seine Eigenständigkeit, daß die vorgestanzten republikanischen Stellungnahmen, die von Heritage, American Enterprise Institute (AEI) und ähnlichen Denkfabriken erzeugt werden, nicht auf ihn abfärben. Nach Aussage seiner Gefolgschaft erteilt Trump den gebieterischen Förderern der RP, wie dem zionistisch besessenen Kasinobesitzer Sheldon Adelson und den Großkapitalisten Gebrüder-Koch („Koch Industries“) aus dem Mittelwesten, die andere republikanische Präsidentenkandidaten mit Geldgeschenken überschütten, eine schroffe Abfuhr. Indem er diese „Leckerbissen“ verschmäht, zeigt Trump sich „unbestechlich“. Ebenso auffallend hebt er sich von Konkurrenten wie Marco Rubio und Jeb Bush ab, die nicht nur von anspruchsvollen Mäzenen umgeben sind, sondern auch parteitreue Stellungnahmen abgeben.
Daß er kein Blatt vor den Mund nimmt und daraus Gewinn schlägt, ist schon weithin bekannt. Was aber verblüfft, ist, wie seine Beliebtheit weiter steigt, auch wenn er ins Fettnäpfchen tritt. Zu den aufsehenerregenden Ausrutschern auf Pressekonferenzen, die für jeden anderen Politiker den Ruin bedeutet hätten, zählen folgende Pannen: die Verspottung eines behinderten Berichterstatters, die Beleidigung einer herausgeputzten weiblichen Konkurrentin, deren „Fresse“ er „nicht mehr ertragen” konnte, und die unbegründete Herabsetzung der Militärkarriere seines politischen Feindes John McCain, der jahrelang in einem Vietcong-Verlies dahinsiechte. Bei jedem von Trump verübten Fauxpas schlugen seine medialen Gegner wütend auf ihn los, doch bisher vermögen sie ihn nicht zur Strecke zu bringen. Trotz des Getöses ist seine Popularität entweder gleich geblieben oder hat sogar einen geringen Anstieg zu verzeichnen.
Ein neu bekehrter Wertkonservativer
Trumps Berühmtheit und seine rasante politische Erfolgsgeschichte sind auf drei zusammenwirkende Faktoren zurückzuführen. Vor seinem Wahlkampfantritt im Juni war er schon eine wirkungsvolle Person im Fernsehen und außerdem einer der namhaftesten Bauunternehmer in den USA. Sein Name war ein landläufiges Kennzeichen, das auf Hotels und Wohnhäusern im ganzen Land prangte. Jahrelang wurde er im Fernsehen als Inbegriff des Arbeitgebers vorgestellt , der seine beflissenen Mitarbeiter anlernt und bewertet. Dadurch prägte sich Trump allen als Unternehmer ein. Vielleicht hat man daraus entnommen, daß der fähige Unternehmer beweisen will, daß er auch das ganze Land genauso gut verwalten kann. Außerdem hat er jahrzehntelang der New Yorker Schickeria angehört, und alles, was als Schickimicki gilt, vertrat Trump bis vor wenigen Jahren vollkommen. Er setzte sich, wie es damals üblich war, für das Recht auf Spätabtreibungen ein und prahlte mit seinem innigen Verhältnis zu Bill und Hillary Clinton. Vor zwei Jahren verursachte es ihm noch kein Unbehagen, den linksradikalen Bill di Blasio, der sich damals um das Bürgermeisteramt in New York bewarb, als „tüchtigen Kerl“ zu bezeichnen.
Angesichts seines schillernden Hintergrunds ist es selbstverständlich, daß sein Ausscheren sowohl aus der Ideenwelt wie auch der Gesellschaft, in der er die meisten seiner siebzig Lebensjahre zugebracht hat, Staunen erweckte. Und nicht weniger verwunderlich ist es, daß manche die Echtheit von Trumps Bekehrung in Frage stellen. Ist jemandem zu trauen, der sich jetzt als Verteidiger „unserer christlichen Zivilisation“ ausgibt, wenn er bis in die jüngste Zeit grundverschiedene Leitwerte hochgehalten hat? In derselben Ansprache, in der er vor einer evangelikalen Zuhörerschaft hochtrabende Worte sprach, zitierte er Bibelstellen falsch. Weiterhin stellte er einen lästerlichen Vergleich zwischen einem von ihm herausgegebenen Ratgeber über Geschäftsverhandlungen und der Heiligen Schrift an. In einer früheren Rede vor der religiösen Rechten erwähnte Trump ironischerweise, daß man es kaum glauben könne, aber er sei als Presbyterianer aufgewachsen. Obwohl seine religiöse Festigkeit sehr fraglich ist, stehen jetzt hinter Trump führende Persönlichkeiten der protestantischen Rechten. Ohne Zweifel halten sie diesen ehemaligen Schwerenöter für den Retter ihrer Ehre.
Die PC erfolgreich ignoriert
Ein zweites Merkmal der Trump-Kandidatur ist der aufgeheizte Kampf gegen die politische Korrektheit. Das findet besonderen Anklang bei jenem anwachsenden Publikum, das sich gegen die linke Obama-Regierung erhebt. Trump ist ein Gegenbild zum amerikanischen Staatsoberhaupt, das sich beeilt, illegalen Einwanderern durch Exekutivgewalt ein Bleiberecht zu gewähren. Obama sorgte dafür, daß der Schornstein weiter raucht, als er Hunderttausende von illegalen Einwanderern und sogar verurteilte schwarze und mexikanische Verbrecher aus dem Gefängnis entließ. Die Forderung, sie abzuschieben, lehnte er ab, und zwar von dem Gedanken getrieben, daß diese Entscheidung helfen dürfte, die Latino-Basis seiner Demokratischen Partei zu festigen. Dummerweise schlägt Obama den vernünftigen Ratschlag aus, muslimische Terroristen als „muslimische Extremisten“ auszuweisen. Während der Präsident nie zögert, „wei?e Rassisten“ und die „befleckte christliche Vergangenheit“ ins Visier zu nehmen, hegt er Bedenken, das antichristliche Kind beim Namen zu nennen. Das führt zu der Vermutung, daß er wegen seiner muslimischen Kindheit in Asien den verbrecherischen Feind mit unangebrachter Nachsicht behandelt.
Mit einem Paukenschlag eröffnete Trump seinen Wahlkampf und verkündete, daß er alle versteckten Illegalen aufspüren und ausweisen werde, wenn er Präsident werden sollte. Dann betonte er mit besonderem Nachdruck, daß er sich um die PC keinen feuchten Kehricht kümmere. Ein paar Monate später schlug er wieder in dieselbe Kerbe und versprach, daß er sogar als Touristen keine Muslime mehr einlassen würde. Obwohl er die Einschränkung einschob, „bis wir die Unterwanderung von islamischen Terroristen unter Kontrolle haben“, ließen die gutmenschlichen Medien den klärenden Nebensatz weg, um die Aussage schärfer zu machen. Der Schuß ging nach hinten los. Statt Trump in ein extremistisches Licht zu rücken und seine Anhänger zu verschrecken, schnellte seine Beliebtheit wiederum nach oben. Einer darauffolgenden Umfrage nach stimmte eine überwiegende Mehrheit von überzeugten Republikanern seiner Haltung zu. Die Tatsache, daß das englische Parlament, der „konservative“ Premierminister John Cameron voran, Ma?nahmen ergriff, um dem „Hetzer“ Donald Trump die Einreise zu verwehren, ging ebenfalls ins Leere. Statt den Gegner zu treffen, erhöhte der Vorschlag nur die Beliebtheit von Trump.
Einsatz für die weiße Arbeiterschaft
In seinen kraftvollen Reden spricht er immer wieder die „schwer angeschlagene“ amerikanische Arbeiterschaft an. Trump verspricht, die finanziell bedrohte einheimische Arbeiterklasse vor dem Einsatz schlechter entlohnter, eingeschleuster Fremdarbeiter zu beschützen. Wie einstudiert die Gebärde auch sein mag, Trumps Getöse bezieht sich doch auf einen wahren Sachverhalt. Aus dem Vorhandensein einer billigen, ungelernten Arbeitskraft aus der Fremde folgt, daß sich sowohl der Lohn wie auch die Einstellungsaussichten für die amerikanischen Geringverdiener verschlechtern. Der Bestand von Zigmillionen illegalen Arbeitskräften setzt den Lebensstandard der amerikanischen Arbeiterschaft herab. Trump beschwert sich auch laut über die unlauteren Praktiken der wirtschaftlichen Rivalen der USA wie Mexiko und China. Sie betreiben hemmungslos Preis-Dumping, um früher gut gedeihende amerikanische Firmen zu schwächen und die amerikanischen Märkte für sich zu vereinnahmen. Trump verspricht, diesem Mißstand ein Ende zu setzen. Mit wirtschaftlich konkurrierenden Nationen will er schlauer verhandeln als die demokratische Regierung, die „dümmliche Botschafter” einsetzt, um Handelsverträge zu schließen.
Trump zaudert auch nicht, andere Großunternehmer anzugreifen, wenn sie etwa Arbeitsplätze und Standorte in Entwicklungs- oder angrenzende Länder verlagern, um Kosten zu sparen. Das wirkt sich zuungunsten der amerikanischen Arbeiterschaft aus; und Trump verkündet, „sobald ich die Präsidentschaft erringe, werde ich mir alles Mögliche einfallen lassen, um die Übeltäter mit zusätzlichen Steuern zu belasten”. Da er mit diesen Leuten einst im selben Boot saß, kennt er ihre Tricks und wird gegen sie ankommen, wenn sie ihren Einfluß zu stark geltend machen. Dabei geht Trump soweit, daß er andeutungsweise vorschlägt, den Umfang der Spenden der Reichen für Wahlkandidaten einzuschränken. Hier ist er mit den Linken einig, die die Wahlkampfzuwendungen in Schranken halten wollen. Aber die Linke zielt darauf, die Einwirkung von Wohlhabenden zugunsten der Gewerkschaften zu reduzieren. Das will Trump keineswegs. Der Machtstellung des aufgeblähten öffentlichen Sektors setzt er sich ebenso stark entgegen wie den Streichen seiner ehemaligen Kollegen an der Börse.
Milieu der Republikaner
bricht ein
Wenn Trump die Haltung und Sprechweise des „schwer arbeitenden Volkes” annimmt, so ist das schon glaubwürdig. Man würde ihn nie mit der längst niedergehenden WASP-Oberschicht identifizieren, die von einem Kandidaten wie Jeb Bush vertreten wird. Bei Trump spürt man die Anwesenheit des vorwiegend aus Katholiken bestehenden New Yorker unteren Mittelstandes, der im allgemeinen demokratisch stimmt. Durch ein sonderbares Schicksal wurde er als Kind einer schottischen Mutter, die ihn in die schottische Staatskirche, den Presbyterianismus einführte, und eines deutschstämmigen Vater geboren. Bezeichnend für sein Milieu ist die abgehackte Sprache, der sprunghafte Satzbau und die emotional aufgeladenen Gebärden. Überraschend scheint es, daß ein Verhalten, das bisher auf eine unbeliebte gro?städtische Lebenswelt deutete, die Einwohner von anderen, weniger modernisierten Landesteilen für sich einnimmt. Entgegen meiner Annahme findet Trump im Mittelwesten und quer durch die Südstaaten ebenso viel Zustimmung wie im New Yorker Umland.
Die dritte Erklärung für seine Beliebtheit ist der Gegensatz zu dem schon in Trümmern liegenden republikanischen Establishment. Als Überbleibsel von anno dazumal fällt es gegenüber einer innenpolitisch tatkräftigeren Demokratischen Partei deutlich ab. Obwohl die letzte republikanische Präsidentschaft von George W. Bush unter der Anleitung seiner aggressiven neokonservativen Berater zu einer kostspieligen Kriegsaktion im Nahen Osten führte, konnte er zu Hause wenig ausrichten. Innenpolitisch lösen Bush und die Politiker seiner Art die gegnerische Partei bestenfalls in regelmäßigem Turnus ab und bemühen sich, die Sozialprogramme der Demokraten etwas einzudämmen. Mittlerweile beschenken die Republikaner bevorzugte Wähler, besonders die einflußreichen Firmenchefs und die zionistische Lobby, mit Sondergefälligkeiten, ohne ihren Regierungsstil auch nur minimal zu ändern. Seit dem Erfolg für die Republikaner, die vor anderthalb Jahren in beiden Bundeshäusern eine Mehrheit erreichten, weicht die Parteiführung jeder größeren Auseinandersetzung mit Obama und den Demokraten aus. Eine Ausnahme bildet die Außenpolitik, ein Bereich, in dem die Republikaner mit ihrer üblichen Kriegstreiberei seit jeher hervorragen. In sozialen Belangen wollen die verantwortlichen Parteiführer sich auf nichts einlassen. Sie warten auf einen Anlaß, die Illegalen zu amnestieren, um die Latinos zu ihrem eigenen Lager herüberzuziehen (ein Traum, der aus verschiedenen Gründen nie eintreffen wird).
Auch bei schwarzen Wählern beliebt
Die Entscheidung des Obersten Gerichts, die Homoehe für ein verfassungsmäßig geschütztes Recht zu erklären, hat die Parteiführung kaum verärgert. Nun ist die brenzlige Streitfrage unter den Tisch gefallen, und statt zu versuchen, aufgrund dieser Dreistigkeit eine Umbesetzung des Obersten Gerichts zu erwirken, wechseln die Parteibonzen das Thema. Sie halten ihre Anhänger dazu an, gegen Putin zu stänkern und andere „menschenrechtliche Bindungen“ der Republikanischen Partei einzulösen. Ebenso sinnvoll kommt es den Parteistrategen vor, intensiv um die Gunst der farbigen Minoritäten, die vermeintlich von den Linken abzuwerben sind, zu buhlen.
Seit dem Beginn dieser abwegigen Werbung ist der Prozentsatz der Schwarzen, die den Republikanern zuneigen, von zirka 8 Prozent auf ungefähr 2 Prozent abgestürzt. Im Gegensatz zu den anderen Kandidaten hat Trump die Aussicht, eine beträchtliche Minderheit (bis zu 30 Prozent) der schwarzen Wähler einzufangen. Statt den Umworbenen zu schmeicheln, verspricht Trump ihnen und den anderen Wählern, ihre Arbeitsstellen gegen Dumping, Verlagerung ins Ausland und die Einstellung von Illegalen abzusichern. Dabei ist zu erwähnen, daß Gro?spender der Republikanischen Partei sich nicht mucksen, wenn die Regierung ihre Geschäfte beaufsichtigen und sie wegen Diskriminierung belangen will. Stets tun sie, was nötig ist, um mit der Regierung zurechtzukommen, aber schreien gegen Trump und seine „Big Government“-Wirtschaftspolitik Zeter und Mordio.
Seit 1992 haben die faden republikanischen Präsidentschaftskandidaten einen Wahlkampf nach dem anderen verloren – mit einer einzigen Ausnahme. Im Jahr 2000 erkämpfte sich der stümperhafte George W. Bush unter Mithilfe unseres eigenartigen Wahlmännergremiums den Sieg. (Bei der Volkswahl hinkte er seinem Gegner Albert Gore um mehr als eine Million Stimmen hinterher.) Vier Jahre danach, mitten in einem von seiner Regierung und ihren Beratern in Gang gesetzten Krieg, siegte Bush über seinen farblosen demokratischen Gegner John Kerry. 2012 brachten die Stifter ihren Auserkorenen Mitt Romney nach vorn, der nach einem verpfuschten Wahlkampf gehörig abgestraft wurde. Dieser vor jeder erdenklichen Auseinandersetzung mit Obama zurückscheuende Geldmann wies eine einzige bemerkenswerte Eigenschaft auf, die sich in dem Satz zusammenfassen läßt: Er hatte ein Vermögen aufgehäuft und lebte wie Gott in Frankreich. Als führender Bekenner des mormonischen Glaubens wurde Romney, sobald die Nominierung auf ihn fiel, mit dem Gütesiegel der prominenten republikanischen Geistlichen zum Christen nach Maß erklärt.
Milliardär als Mann der Basis
Um das Faß zum Überlaufen zu bringen, schmückt sich das republikanische Establishment mit der Ehrenbezeichnung „conservative“. Das ist ein bis zur Bedeutungslosigkeit verblaßter Anspruch, den unsere neokonservativen Journalisten an ihre Schutzbefohlenen vergeben. Die linken Medien tun dasselbe aus dem offensichtlichen Grund, daß sie lieber mit flauen Gemäßigten als mit einer entschlossenen Opposition verhandeln möchten. Demzufolge wird Trump und sein Anhang in die faschistische oder rechtspopulistische Ecke gerückt. Als „Konservativer schlechthin“ versuchte das Establishment hingegen den jüngeren Bruder George W. Bushs, Jeb, zu verkaufen. Das bedeutet die Bereitwilligkeit, den Linken hinsichtlich der Einwanderung und anderer heikler sozialer Anliegen nachzugeben. Durch eine künftige Mitwirkung bei der Oppositionspartei könnten es Jeb Bush oder Marco Rubio erreichen, so lautete die Hoffnung, einen Steuerabzug für Firmen und Aktienanleger auszuhandeln. Für die Parteiführung und ihre neokonservativen Berater haftet dem Wort „conservative“ ein eigentümlicher Sinn an. Er deckt Positionen ab, die mit den Sonderinteressen der Herrscherklasse übereinstimmen. Zum Leidwesen derselben Eliten stimmen jedoch ihre Interessen mit denen der sozial entfremdeten, wirtschaftlich verdrossenen Parteibasis nicht mehr überein. Daher rührt die Spaltung, die Trumps Aufstieg den Weg bahnte.
Geröchel
einer sterbenden Zeitschrift
In der dritten Januarwoche brachte die republikanische Zweiwochenschrift „National Review“ eine Sonderausgabe heraus, die mit einer hochgespielten Entlarvung des „antikonservativen“ Trumps aufmachte. Begründet 1955 von dem Salonlöwen und „öffentlichen Intellektuellen“ Wiliam F. Buckley, der die Redaktion jahrzehntelang versah, hat sich sein Produkt mittlerweile zu wahlweise einer verwahrlosten Provinz des neokonservativen Medienreiches oder einem entbehrlichen Werkzeug der Republikanischen Partei entwickelt. Während des Kalten Krieges bewährte sich die „National Review“ als Bollwerk des Antikommunismus. In den ersten zwanzig Jahren standen Buckley und seine Redaktion sowohl mit europäischen Konservativen von echtem Schrot und Korn (zum Beispiel Erik von Kuehnelt-Leddhin und Thomas Molnar) wie auch mit den südstaatlichen Landbesitzern und mit amerikanischen Kritikern der nach links treibenden Wohlfahrtsregierung auf vertrautem Fuß. In den frühen 1970ern jedoch geriet die Zeitschrift allmählich unter die Kuratel der schon in Schwung kommenden Neokonservativen. Anläßlich seines Rücktritt aus dem öffentlichen Leben übergab Buckley die Weiterführung seines vielfach veränderten Unternehmens einer von seinen neokonservativen Freunden empfohlenen Mannschaft.
Neuer Chefredakteur wurde 1997 ein junger Absolvent der Virginia-Universität namens Rich Lowry, der gerade sein Journalismus-Studium beendet hatte. Zu Lowrys Berufseignung zählt seine atemberaubende geschichtliche Unkenntnis (er ignorierte beispielsweise jeden Unterschied zwischen dem Zweiten Deutschen Kaiserreich und dem Dritten Reich), und „kreative“ Neudefinition konservativer Prinzipien, seine Redakteure erheben etwa die Homoehe zu einem „konservativen Familienwert“. Wie nicht verwunderlich, erregt Lowry bei der multikulturellen Linken kaum Missvergnügen. Wie sein Vorgänger möchte er von seiner PC-Publikation alles fernhalten, was rechts von den Neokonservativen steht. Man geht so weit, daß niemand weiterhin für die „National Review“ schreiben dürfe, wenn er nicht auffallend nach links gerückt war.
Doch Lowry griff daneben, als er die Entscheidung traf, in seiner Zeitschrift „konservative Prinzipien“ gegen den streitlustigen Trump zu verteidigen. Um die Einsendung von Schimpfkanonaden gegen Trump hatte er bestimmte Mitarbeiter inständig gebeten. 24 Journalisten ließen sich einfangen und lieferten die entsprechende Kritik. Nicht alle schrieben in der gewünschten Einseitigkeit. Obwohl auch sie gravierende Bedenken gegen Trump äußerten, hielten sich fast die Hälfte der Beteiligten die Option offen, dennoch für ihn zu stimmen. Unter den entschiedenen Trump-Gegnern sammeln sich die sozial links eingestellten Neokonservativen. Dieser bemerkenswerten Untergruppe gehören John Podhoretz, Mona Charen und Bill Kristol an, alle begeisterte Fans der Homoehe. Eine Vielzahl der Kommentatoren verabscheut Trumps Hauptkonkurrenten Ted Cruz, der als „ma?geblicher Rechtsrepublikaner” gilt, ebenso tief wie den geschmähten Trump.
Aus diesem Trubel läßt sich immerhin eine Zeitströmung ableiten. Von dem Zusammenschluß mit den linken Medien abgesehen, ist die Bestrebung im Sande verlaufen. Und doch hat sie bemerkenswerte Reaktionen hervorgerufen: Gegen sie trat die schon vergreiste, halb verschwundene amerikanische Rechte, ausgehend von Pat Buchanan und Phyllis Schlafley, zum Kampf an; und von vielbeachteten Mediengrößen wie Rush Limbaugh, die den Linksruck der „National Review“-Redaktion kritisierten, wurde ihr sekundiert.
Der scharfsinnige junge Philosoph Jack Kerwick liefert eine lesenswerte Analyse des Anti-Trump-Lagers (erstaunlicherweise) auf dem allgemeinen republikanischen Portal Townhall. Kerwick beweist hieb- und stichfest, daß die meisten gegen Trump argumentierenden Kommentatoren nur immer wieder die früheren republikanischen Präsidentschaftskandidaten über den grünen Klee loben. Überdies haben dieselben Leute Bush und Romney als lupenreine konservative Präsidentschaftskandidaten bezeichnet. Ein Libertärer, David Boaz, der die Mannschaft der „National Review“ alphabetisch anführt, legt sich schon lange für Schwulenrechte ins Zeug. Das führt, so Kerwick, zu der Gretchenfrage, weshalb die erwähnte Auflistung als Offensive von „konservativen“ Prominenten ausgelegt wird. Von den Mitbeteiligten scheinen manche den linken Medien näher zu stehen als einer glaubwürdigen Rechten. Trumps Reaktion auf die von „National Review“ ausgehende Stänkerei, daß darin nur das Geröchel einer sterbenden Publikation zu vernehmen sei, stimmten andere Kritiker zu. Daraufhin stiegen Trumps Beliebtheitszahlen nochmals sprunghaft an.
Erste Vorwahlen
In der dritten Februarwoche und dann am 1. März (Super Tuesday) errang Trump beeindruckende Ergebnisse in den Vorwahlen meist im amerikanischen Süden. Nach einem zweitbesten Finish in Iowa und Siegen in New Hampshire, South Carolina und Nevada verzeichnete Trump seine bisher größten Wahlerfolge am „Super Tuesday“, als er in sieben von elf umstrittenen Bundesstaaten die meisten Stimmen einheimste. In dieser fortgeschrittenen Phase des Rennens würden die Parteiführer üblicherweise beginnen, sich mit dem unbestreitbaren Spitzenkandidaten abzusprechen. Doch jetzt sieht alles anders aus. Das republikanische Establishment sucht nach einem „Nicht-Trump-Kandidaten“, irgendjemanden, mit dem die Parteiführung gut auskommen kann, und der ihren Interessen restlos entspricht. Und das folgt auf einen allgemeinen Angriff gegen Trump, der eine weniger wehrhafte Zielscheibe zerstört hätte. Zu den ehrenrührigen Angriffen zählen unbegründete Anschuldigungen, daß Trump dem Ku Klux Klan nahesteht, daß er von den italienischen Faschisten beeinflußt wurde, und daß er mit der Mafia umfassend vernetzt sei.
Der kubanischstämmige Senator aus Florida, Marco Rubio, ist der Auserkorene der Partei-Elite. Rubios Nominierung würde sie in Entzücken versetzen; jedoch muß man sich fragen, ob dieser Streich noch zu führen ist. Man sollte die Tatsache nicht aus den Augen verlieren, daß Trump bisher mehr als doppelt so viele Stimmen bekommen hat wie Rubio. Hinzu kommt, daß, wenn die Parteibonzen sich bemühen, Trump auf Biegen oder Brechen die Nominierung abzusprechen, er sich (wie mehrmals angedroht) auf „verzweifelte Ma?nahmen“ verlegen würde. Darunter versteht er, eine „Dritte Partei“ zu begründen mit sich selbst als Kandidaten. Daraus würde sicherlich ein Wahlsieg für die demokratische Kandidatin Hillary Clinton folgen, eine Niederlage, die weder Trump noch seine republikanischen Gegner bezweifeln können.
Eine zweite strategische Möglichkeit für die entschlossenen Trump-Gegner besteht darin, zu Trumps ausgesprochen „rechtsrepublikanischen“ Konkurrenten Ted Cruz Brücken zu schlagen. Aus zwei Gründen scheuen die Verantwortlichen vor diesem Schritt zurück. Vor allem ist Cruz wie Trump gegen eine gelockerte Immigrationspolitik, die zu billigen Arbeitskräften führen würde. Zum anderen distanzierte sich Cruz in der Hitze des Gefechts mit Rubio rhetorisch von einer von den Neokonservativen befürworteten Au?enpolitik. Cruz gerät in (vielleicht gekünstelte) Gereiztheit über die „weltweite Einmischerei“ der Kandidaten des republikanischen Establishments, die von bedenklichen ausländischen Abenteuern nicht lassen können. Es ist keineswegs übertrieben zu behaupten, daß die Parteiführung mit zwei Optionen spielt, nämlich einerseits fremde Erdteile unter die Kuratel „der führenden Macht der freien Welt“ zu nehmen und andererseits aus der Dritten Welt Zugezogene als eine unerschöpfliche Quelle für billige Arbeitskräfte zu nutzen. Überdies ist Cruz ein andächtiger Evangelikaler, der den linksliberalen Kurs des Establishments in sozialpolitischen Belangen glatt ablehnt. In dieser Hinsicht, wenn auch in keiner anderen, stellt der umtriebige Trump eine Alternative dar, die den Parteioberen weniger zuwider ist.
Der einzig einsichtige „Stop Trump“-Plan, den das Establishment vorlegt, besteht darin, die weniger zugkräftigen Kandidaten (mit Zucker oder Peitsche) hinauszudrängen und dadurch das Schlachtfeld für eine Gegenüberstellung zwischen Trump und Rubio vorzubereiten. Vermutlich sind die „gemä?igten“ Kandidaten eher Rubio als Trump zugeneigt; und sobald das Handgemenge zu einem Zweikampf gerät, wird Rubio (so hofft man) in den Stand gesetzt, eine Mehrheit der wahlberechtigten Republikaner in seinen Bann zu ziehen. Nach dem bisherigen Kenntnisstand hat es Trump au?er im bevölkerungsarmen Nevada nirgendwo erreicht, mehr als ein Drittel bis vierzig Prozent der Stimmen zu bekommen.
Dazu kommt, daß nach kürzlich angestellten Umfragen sowohl Cruz als auch Rubio in einem Kopf-an-Kopf-Rennen Trump um 16 Prozent schlagen würden. Unter den „Mä?igen“ schied Jeb Bush nach einem enttäuschenden Wahlergebnis in South Carolina aus dem Wahlkampf aus. Jedoch haben die anderen holprigen Konkurrenten, nämlich John Kasich und Ben Carson, keine Lust gezeigt aufzugeben. Seit dem Ausscheiden Bushs haben sich die Stimmenanteile der jeweils verbleibenden Kandidaten eingependelt. Aus der verringerten Anzahl der Kandidaten hat Rubio bislang keinen bedeutenden Gewinn herausholen können.
„Alte“ und Neue Demokratie
Im Gro?en und Ganzen gesehen steht das Establishment keiner erfreulichen Situation gegenüber. Die Bedenken gegen Trump sind wohl begründet; und egal, ob er die Nominierung erreicht oder nicht, ergibt sich aus seiner Kandidatur eine einschneidende Veränderung in der alltäglichen amerikanischen Politik. Mit seinem Anruf an „das amerikanische Volk” über das Zweiparteiensystem hinweg stellt Trump ohne Zweifel neue Weichen. Er stellt der verankerten und möglicherweise ausgedienten Vorstellung von der amerikanischen „Liberaldemokratie“ eine neue Auffassung entgegen. Anders als die Lehrmeinung unserer herrschenden Politikwissenschaftler und Demokratie-Missionare es will, die eine funktionierende demokratische Praxis mit dem üblichen Parlamentarismus identifizieren, gilt Trump als Vorbote eines neuen Musters.
Aufgrund dessen wird eine „Demokratie“ auf Bundesebene als das Verhältnis zwischen einer parteilosen Wählerschaft und freischwebenden Kandidaten als eine bis vor kurzem ungeahnte Möglichkeit wenigstens erkennbar. „Demokratie“ ist nicht mehr gleichbedeutend mit dem Stühlerücken der beiden in Gestalt der Großparteien auftretenden Interessengruppen. Bis zum Auftreten Trumps waren darüber hinaus die Begriffe „conservative“ und „liberal“ von den zwei Altparteien dauerhaft geprägt. Journalisten und Politiker legten sich ideologische Standortbestimmungen zu oder wurden aufgrund ihrer Zuordnung einer der zwei amtlichen Parteien zugewiesen. Zur Kenntnisnahme: Die amerikanischen Gründerväter wetterten gegen die Einflußnahme der „Nationalparteien“, die eine verfassungsmä?ig begrenzte Volksregierung mit Filz und einer kostspieligen Politikerklasse belasten würden. Was die Gründerväter befürchteten, eine im Turnus wechselnde, aber verfestigte und eingerostete Parteibürokratie, wurde ironischerweise zum Wahrzeichen einer weltweit „vorbildhaften“ demokratischen Praxis.
Enttäuschte Intellektuelle schließen sich an
Daß Trump als „game changer“ dient, ist ein Selbstläufer. Eine jahrzehntelang vernachlässigte Wählerschaft, bestehend vorwiegend aus wei?en Arbeitern mit sinkendem Lebensstandard, drängt sich um seine Kandidatur. Dieser Koalition gesellt sich eine über das republikanische Establishment verdrossene altrechte Intelligenz im Bund mit Evangelikalen hinzu. Wie die neokonservative Publizistin Mona Charen, die Nase rümpfend, jüngst bemerkte: Irrig wäre es anzunehmen, daß die Gesamtheit der Trump-Anhänger aus Ungebildeten besteht. Immer öfter schlie?en sich dem Proletariat namhafte Gelehrte an, die mit „ihrer Abscheu vor der republikanischen Rangordnung nicht hinterm Berg halten“. Offen bleibt, ob der hochfliegende Trump sein Ziel erreichen wird, oder ob sich das Establishment rechtzeitig aufraffen kann, ihm einen Strich durch die Rechnung zu machen. Mag sein, daß seine ungezügelte Zunge, die ihm früher zum Vorteil gereichte, ihm in Zukunft schaden wird. Sicher ist jedoch, daß der Zeitgeist, der ihn begleitet und ihm Auftrieb gibt, nicht so bald weichen wird.
Unerachtet meiner Bedenken über Trumps sprunghafte Redeweise und seine bösen Seitenhiebe lasse ich ihn jedesmal hochleben, wenn mir bewußt wird, wie gründlich seine neokonservativen Verächter ihn fürchten. Höher schlug mein Herz letzte Woche, als ich das gedruckte Jammergeschrei des unbegabten Nachkommen einer mächtigen neokonservativen Familie, John Podhoretz, zu Gesicht bekam: „Zu unserem Bedauern verscherzten wir uns die letzte Chance, dieser unseren ausgleichenden Einfluß vernichtenden Gewalt standzuhalten”. Mögen sich die Feinde meiner Feinde vermehren!