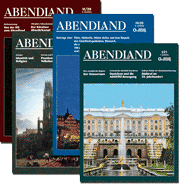Schota Rustaweli - Um Georgien die Ehre zu geben
Von Gerd-Klaus Kaltenbrunner
Georgien, von den eisigen Südhängen des Kaukasus bis zu den subtropischen Niederungen an den Küsten des Schwarzen Meers reichend, ist uralter Kulturboden. Die ersten Spuren lassen sich bis zu den assyrischen Keilinschriften zurückverfolgen. Georgien ist das antike Kolchis, von alters her zwischen Griechen und Persern, später von Römern und Sassaniden, Byzantinern und Arabern, zuletzt von Russen und Türken umstrittenes Land, und dennoch trotz aller Einflüsse, Abhängigkeiten und Invasionen seine Eigenart bis heute unerschüttert bewahrend. Weltreiche kamen und gingen, Throne barsten, Dynastien schwanden spurlos, aber Georgien blieb: Georgien, Kolchis, Iberien – wie das östliche Gebiet einst hieß –, mythenumwobenes Geheimnisland, gebirgiger Sitz griechischer Götter und Heroen, gipfelreiches Golgotha des Titanen Prometheus, des Feuerbringers und Vorkämpfers der Menschheit … Georgien, älter als Troja, Heimat des Goldenen Vlieses und der zauberkundigen Jungfrau und Hekatepriesterin Medea, Ziel des Zugs der Argonauten, Zwischenhalt des die Hesperidenäpfel suchenden Herakles, der den peinbringenden Adler des Zeus mit seinem Pfeil erlegte …
Georgien, Götterland, wo Hephaistos’ Schmiedewerkstatt stand, auf dessen schneebedeckten Bergen die Olympier nach der Sintflut weilten, die einzig Deukalion, der griechische Noah, mit dem Weibe Pyrrha in seiner Arche überstand …
Land der Helden, Land des prometheusverwandten Amirani, dessen Sandale die Erde, dessen Hut der Himmel ist … Land des Elbrus und Kasbek, Land der Höhen und Hohen, der Hochgemuten und Hochsinnigen, den Alten das Ende der Welt, in Wahrheit Brückenjoch zwischen Abendland und Orient, Umschlagplatz und Scheideweg der Völkerschaften Europas wie Asiens, Mittlerin zwischen Griechen und Persern, Haltepunkt an der Straße des Austauschs bis nach Indien und dem Fernen Osten, Treffpunkt der Kaufleute und Fernfahrer, vielsprachig durchhallte Felsenzinne und Meeresküste …
Urgestein Georgien, erratischer Block längst untergegangener Rassen, letzte überlebende Hieroglyphe verschollener Völker, Terra incognita, Freistätte entschwundener Scharen, Beisassen und Siedler, von denen wir manchmal kaum mehr als den Namen kennen, Fluchtburg vielleicht entfernter Verwandter der Japhetiden, Hethiter, Sumerer, Basken und Etrusker, vielleicht aber auch Asyl mit keinem andern Stamm verschwisterter Autochthonen …
Sprache Georgiens, archaischer Reichtum, Schatzkammer ältester, vorindogermanischer Überlieferungen der weißen Rasse, weder mit dem Russischen noch sonst einer slawischen Sprache verwandt, als unerlernbar geltendes Entzücken der Philologen, voll von linguistischen Juwelen, rauh, melodisch, bildhaft und tiefsinnig!
Wo gibt es noch eine Sprache, in der eine schwangere Frau „die Zweiseelenvolle“ (Orsuli), der Getreue „der Einherzige“ (Ertguli), der Abtrünnige „der Zweiherzige“ (Orguli), der Vater Mama, die Mutter Deda und der Pflüger „die Mutter des Pflugs“ (Gutnis deda) heißen?
„Wär’ nicht das Auge sonnenhaft, die Sonne könnt’ es nie erblicken“, dichtet Goethe, platonisch-plotinische Weisheit ins Deutsche übersetzend. Aber in kaum einer zweiten Sprache der Welt hat das Wort „schauen“ (Msera) dieselbe Wurzel wie „Sonne“ (Mse). Das Auge ist für den Georgier mehr als sonnengleich: Es ist die Sonne selbst. Wenn die Trauben im sonnenverwöhnten Bergland des Südens reifen, pflegt der georgische Winzer zu sagen: „Das Auge ist in die Frucht des Weinstocks eingegangen.“
Menschsein ist Sonnesein, Sonnesein ist Signatur unserer göttlichen Abkunft. Wenn wir beschwörend sagen: „Bei Gott“, spricht der Georgier: „Bei deiner Sonne!“ Wohlgemerkt: Die Rede lautet nicht einfach „bei der Sonne“, sondern „bei deiner Sonne“, weil jeder Mensch, wie einen eigenen Schutzengel, seine ihm eigene, persönliche Sonne hat, Anteil am Göttlichen genießendes Sonnenkind ist. „Der Liebende sei dem Auge schön und strahlend wie die Sonne“, heißt es im Prolog des ganz und gar von Lichtmystik durchwobenen georgischen Nationalepos „Der Mann im Pantherfell“. Die Königin Tinatin wird darin gepriesen als „das strahlende Licht der Welt, das auch die Gestirne beseelt“. Ihr Ritter Awtandil hat ein „Sonnenantlitz“. Wenn er von seiner Fahrt zurückkehren werde, wolle sie ihm „wie die Sonne entgegengehen“, verspricht die Geliebte beim Abschied. Awtandils Freund Tariel wird von seiner gefangengehaltenen Braut Nestan getröstet: „Die Sonne wird ohne dich nicht sein, weil du ihr Teil bist.“
Lichtwendige Sprache Georgiens, reich an Photismen und Heliotropismen, sonnenhaltige Sprache, illuminierendes Idiom, in das, wie in die gesegnete Traube, die antlitzhafte Sonne eingegangen ist, die Sonne Gott, dessen erhabensten Würdetitel die Huldigung nennt: „O du Antlitzhafter!“ (O schen ssachiero!)
Fürstliches, verschwenderisches, vielfältiges, das Sein sinnfällig-geistdurchdrungen zur Sprache bringendes Georgisch … Wenn wir Deutsche „alles“ sagen, spricht der Georgier: „alle Farben“, „nichts“ bedeutet „farbenlos“; und er fragt zuweilen statt „Wie hast du es gemacht?“ – „Wie farben hast du es gemacht?“. Ist einem eine zweite Sprache bekannt, in der die Wörter „Mut“, „Schicksal“ und „Glück“ ein und derselben Wurzel entspringen? In der es für die gleichen Handlungen völlig verschiedene Ausdrücke gibt, je nachdem, ob sie im weltlichen oder im sakralen Raum vollzogen werden? Wenn ich eine Frau küsse, dann heißt dies im georgischem Wortlaut: Kozna. Wird eine Ikone geküßt, dann verfügt das Georgische dafür über ein eigenes Wort: Ambori. Wird zu Hause oder in einem Konzertsaal gesungen, dann spricht der Georgier von Simghera; für den Gesang in der Kirche gibt es das Tätigkeitswort Galoba. Wozu wir einen ganzen Satz benötigen, um zu sagen: „Ich werde es ihm schreiben“, benötigt das Georgische nur ein einziges Wort: Miwszer. Umgekehrt hat es aber unzählige Male für ein und dasselbe Ding mehrere Ausdrücke, um es in seinen verschiedenen Anblicken, Abstufungen und Farben unzweideutig zu bezeichnen. Ein Ochse mit nach unten gebogenen Hörnern heißt anders als einer mit aufwärts gerichteten. Ein Mann kann ein „Herr“ sein, ein Batoni; Gott, der Herr, ist aber kein Batoni, sondern Uphali. „Herrschaft“ leitet sich aber im Georgischen nicht von Batoni ab, sondern von Uphali. Wahre Macht ist von sakraler Wesenheit, gründet in Gott. Der König, Chelmzipe, ist „der mit der reifen Hand“ …
Welch hinreißendes Bild des Königtums: Die Krone gebührt demjenigen, der eine gereifte, eine entwickelte, eine vollendete und vollendende Hand hat: eine reiche Hand, die fürstlich schenkt; eine begnadete Hand, die priesterlich segnet; eine schlagkräftige Hand, die sich mit der Waffe zu wehren versteht …
Transkaukasisches Dreieckland
Transkaukasisches Dreieckland ist Georgien zwischen Armenien, Aserbaidschan und der Türkei, westlich angrenzend an das Schwarze Meer – den Pontos Euxinos der Alten – und im Norden benachbart den Bergvölkern der Tscherkessen und Kabardiner, der Osseten und Karatschaier, der Inguschen und Tschetschenen, der Darginer und Lesgier, der Agulen und Laken. Der Fläche nach doppelt so groß wie die Niederlande, aber weit weniger als die Hälfte ihrer Einwohnerzahl aufweisend, ist Georgien eine der schönsten Zonen der Erde, im weitfirnigen Gebirge so großartig erhaben wie die Alpen des Engadins – mehr als die Hälfte des Lands liegt über der Tausendmetergrenze, nur ein Achtel georgischen Bodens unter 200 Metern –, in seinen tieferen Lagen von fruchtbarer Üppigkeit wie Norditalien, ebenso reich an Weizen und Wein, Orangen und Zitronen, Tabak und Tee wie an Wasserkraft, Heilquellen, Mangan, Kohle und andern Bodenschätzen.
Heiliges Georgien
Heiliger Boden Georgiens, heilig nicht nur den Georgiern und Griechen … Auf dem Doppelgipfel des Elbrus nistet der unsterbliche Wundervogel Simurgh des iranischen Mythos: Simurgh, der menschenferne Beschützer der Helden, ausgestattet mit der Gabe der Sprache, das auch die Islamisierung Persiens überdauernde Sinnbild des arischen Lichtgotts Ahura Mazdah-Ormuzd, der noch im „Schahname“, dem „Königsbuch“ des Firdausi, und in den „Vogelgesprächen“ des Mystikers Attar gefeierte himmlische Adler … Sein Flügelschlag erzeugt Sturm, unter seinen Schwingen erzittert die Erde, bei seinem Schrei verstummen alle Wesen; wenn er aber melodisch singt, dann ertönt es wie Sphärenharmonie, ruhen die von ewigem Eis bekrönten Gipfel in strahlendem Lichtglanz der von keinem Wölkchen getrübten Sonne … Der Adler des Zeus, der den Prometheus peinigende Qualvogel, und der den Heroen beistehende, von den Mystikern als Siegel der All-Einheit gesichtete Simurgh sind Kaukasier …
Boden Georgiens, heilig auch den Bekennern des Christentums, das der Legende nach im ersten Drittel des 4. Jahrhunderts von der aus Kappadokien kommenden heiligen Jungfrau Nino eingeführt ward. Nino aber hatte kurz zuvor Helena, die wenn schon nicht aus Trier gebürtige, so doch mit Trier und Xanten, Bonn und Köln – den deutschrömischen Städten an Rhein und Mosel – verbundene Mutter des späteren Kaisers Konstantin, zum Christentum bekehrt.
Welch überwältigende Ausblicke durch die Ritzen der Legende in geschichtsmächtige Zusammenhänge! Nino, die Urapostolin Georgiens, ist auch die Bekehrerin der heiligen Schutzpatronin der deutschen Städte Trier und Bamberg sowie der einstigen Reichsstadt Basel, der Jerusalempilgerin und Kreuzauffinderin Helena, der Mutter Konstantins des Großen, der auf unzähligen Ikonen der Ostkirche dargestellten Erzheiligen von Byzanz, der Stifterin der Apostelkirche zu Konstantinopel, der Heiligkreuzkirche zu Rom und der Geburtskirche zu Bethlehem.
Nino bekehrte Georgien zum Christentum, indem sie aus Weinrebenholz ein Kruzifix schnitt und mit ihren Locken umwickelte. Dieses Kreuz – das Palladium des Lands – ruht heute, nach vielen Odysseen, in der Sionkathedrale der Hauptstadt Georgiens, in Tbilissi.
Nino ist der Beginn der Christianisierung Georgiens, das schon früh kirchliche Selbständigkeit gewann. Dem in Tbilissi residierenden Katholikos kam beinahe die Stellung eines Papsts zu. Er ist auch heute vom Moskauer Patriarchat ebenso unabhängig wie von Rom oder sonst einem außergeorgischen Bischofssitz.
Heiliger Boden Georgiens, getauft und geweiht durch die Christen, denen der Kasbek als der Christusberg gilt, auf dessen Gipfel sich Abrahams Zelt und Jesu Krippe befinden. Manche Legenden versetzen das Paradies nach Georgien, andere den Heiligen Gral oder dessen Hüter, den in der Chronik Ottos von Freising und gegen Schluß von Wolframs „Parzival“ erwähnten Priesterkönig Johannes …
Georgien – trotz aller Bedrängnisse und Verheerungen ein Königreich vom 6. bis zum Ende des 18. Jahrhunderts, ohne unmittelbare Einflußnahme des Abendlands ein kleines Spiegelbild Europas.
Vieles, was uns vertraut ist, finden wir auch hier: Legenden und Passionale, Rittertum und Minnesang, Platonismus und Aristotelismus, Patristik und Scholastik, Heldenepos und Chronistik, Mönchtum und Burgenbau, Goldschmiedekunst und Kalligraphie, vor allem aber auch eine Monumentalarchitektur, die in vieler Hinsicht an die fast gleichzeitig entstandenen Bauten der abendländischen Romanik erinnert. Wer die Georgskathedrale in Alawerdi, die Nikolauskirche in Nikorzminda, die Katholikoskathedrale in Mzcheta, die mehrere Kirchen und Kapellen umfassende Klosteranlage in Gelati, die Sionskirche in Ateni, die Kathedrale von Samtawissi, die Palastkirche der Zitadelle von Kwetera, die Kirchenburg von Ananuri und andere Heiligtümer und Festungen des Lands erblickt, denkt unwillkürlich an deren Schwestern am Rhein. Sie gleichen weit mehr den Domen und Pfalzen in Aachen, Andernach, Mainz, Worms und Speyer als den räumlich doch viel näher gelegenen Kathedralen und Kreml Rußlands und Byzanz’.
Die Kathedrale von Bana in Südwestgeorgien, heute türkischem Gebiet, die hochgelegene Dshwarikirche über dem Kuratal in Mzcheta und der Kreuzkuppelbau in Zromi erinnern an die Gralstempelschilderungen im „Parzival“ und „Jüngeren Titurel“, ähnlich wie in Georgien weitverbreitete Heiligenviten ein liebevolles Verhältnis zwischen Mensch, Tier, Pflanze und Elementen, ein kosmosfrommes Christentum schildern, das an Franziskus von Assisi, Giotto und Wolfram von Eschenbach gemahnt.
Goldenes Zeitalter unter den Bagratiden
Georgien im Mittelalter – nie wieder erreichter Gipfel, goldenes Zeitalter unter der glücklichen Herrschaft der Bagratiden, die nicht nur siegreiche Krieger und Mehrer des Reichs, sondern auch Freunde der Musen und Mäzene der Dichter waren, Gründer von Kirchen und Akademien, mit Philosophen und Annalisten von gleich zu gleich sich unterredende Liebhaber von Intelligenz und Bildung. „Es wehte ein wohltätiger Wind. Und es erglänzte die Sonne über der Dunkelheit“, berichtet der Chronist.
Georgien erstreckte sich damals, auf dem Höhepunkt seiner Macht, vom Schwarzen Meer bis zum Kaspisee, umfaßte Teile Irans und Armeniens, gelenkt von ruhmreichen Königen, von deren Triumphen heimkehrende französische und deutsche Kreuzfahrer dem Abendland Kunde brachten. Die Kette reicht von Bagrat III. dem Einiger († 1014) zu David dem Erbauer († 1125), von Georg III. († 1184) bis zu dessen Tochter und Davids Urenkelin Thamar († 1213). Eine Legende sagt, daß Thamar, bereits in jungen Jahren Mitregentin ihres Vaters, nicht gestorben sei. Sie schlummere nur in einer goldenen Wiege, um dereinst aufzuwachen und ihrem bedrängten Volk zu neuer Blüte zu verhelfen.
Thamar ist aber auch wirklich nicht gestorben, denn sie lebt bis auf den heutigen Tag in der Erinnerung ihres überlieferungsstolzen Volks fort von Gnaden der Dichter, die sie verherrlicht haben.
Unsterblich, solange das Georgische keine tote Sprache sein wird, ungeachtet des Wechsels der Regime und xenokratischen Hegemone, lebt Thamar in den Versen des Preisgedichts von Tschachruchadse:
Thamar, die sanfte, die milde, hold redend mit
lächelndem Antlitz,
Strahlend wie die Sonne, ein hehrer Anblick,
Quelle des Lebens, segensreich strömend …
Thamar ist das Nationalepos der Georgier gewidmet, mit dem dieses kleine Volk sich schlagartig in die Weltliteratur hineingeschwungen hat: „Der Mann im Pantherfell“ („Wepchis Tkaossani“) von Schota Rustaweli, der höchstwahrscheinlich ein hohes Amt am Hof der Herrscherin bekleidet hat. Von dieser Königin sagt ein anderer Zeitgenosse, der Abt Melchisedek Ukwdawebis Mocikuli des Klosters Angelozebissawane: „Wer sie einmal erblickt hat, der ist gegen alle andern Verführerinnen gefeit.“
Thamar ist nicht nur das Epos des Schota Rustaweli gewidmet, des georgischen Homer, sie selbst ist das Urbild Tinatins, einer seiner Hauptfiguren, der Prinzessin, Mitregentin und schließlich Königin. Obwohl Thamar nacheinander mit zwei anderen Männern verheiratet war, zuerst mit dem Russen Jurij, dann mit dem tapferen ossetischen Prinzen David Soslan, ist eigentlich der Dichter Schota Rustaweli ihr wahrer Seelenverwandter gewesen.
Auf Poesie ist die Sicherheit der Throne gegründet. Dichtung stiftet Völker. Nationwerdung entspringt gelegentlich der schöpferischen Imagination des analog Gottvater durch sein Wort Welten entstehen lassenden Künstlers: Fiat lux, „Es werde Licht!“. Ganze Völker existieren zuerst bloß in den Köpfen und Herzen einiger weniger Träumer, von denen spätere Geschlechter kaum mehr als den Namen kennen.
Was wissen wir schon über Homer, über Shakespeare, über die Dichter der Edda, des Kalevala, des Buchs Hiob und der Psalmen, des Mahabharata und Ramayana, des Tao-te-king und des Totenbuchs der Ägypter?
Auch über Schota Rustaweli wissen wir nur wenig Genaues, außer daß er sein Werk um das Jahr 1200 geschaffen hat, also etwa gleichzeitig wie in deutschen Landen Wolfram von Eschenbach den „Parzival“, Hartmann von Aue den „Armen Heinrich“, „Erec“ und „Iwein“, Gottfried von Straßburg den „Tristan“. Ruth Neukomm, die immer noch viel zu wenig bedankte Vermittlerin georgischer Poesie durch ihre hingebungsvolle Übersetzertätigkeit, bemerkt dazu: „Wie um Homer und Shakespeare herrscht geheimnisvolles Dunkel um Schota. Fest steht nur, daß er sich selbst im Epos unter dem Namen Rustaweli, das heißt ,der von Rustawi‘, nennt. Es gibt aber zwei Orte in Georgien, die Rustawi heißen, so daß des Dichters engere Heimat nicht ohne weiteres bestimmt werden kann. Auch sind weder sein Geburtsjahr noch dasjenige seines Todes bekannt.“
Biographisch wissen wir unendlich wenig, als Leser seiner Dichtung erfahren wir alles über Schota Rustaweli. Er ist im Reiche der Poesie, was Thamar im Staate war: König, Chelmzipe, „der mit der reifen Hand“.
Wie in den Sternstunden der Antike – Pindar am Hof des Fürsten von Akragas, Vergil als berufener Dichter des Augusteischen Friedens –, so erscheint auch in der goldenen Epoche Georgiens, da gleichzeitig Staat und Dichtung blühten, der Poet als rangebenbürtig neben der Königin, gleichsam als deren Entsprechung und Glorie. Die Höhepunkte der großen Politik erhalten ihre mit rein politischen Mitteln unerreichbare Überhöhung kraft des nimbusstiftenden Worts der Dichtung.
Auch ein kleines Volk, ein kleiner Hof, die im Konzert der Mächte wenig bedeuten, können dadurch den Ruhm von Imperien überschatten. Wie öde und unfruchtbar erscheint das Napoleonische Kaiserreich neben dem mitteldeutschen Liliputstaat Sachsen-Weimar, wo auf engem Raum gleichzeitig Goethe, Wieland und Herder wirkten! Höhepunkte überlieferungsverwurzelter Staatlichkeit sind immer auch Augenblicke, in denen Sänger und Täter, Herrscher und Dichter, Träumer und Thronberechtigter in konkreter Deutlichkeit als aufeinander angewiesene, als einander ergänzende Figuren im Welttheater erblickt werden.
Ein Regiment ohne Musen entbehrt jener Salbung, ohne die jeder Anspruch auf Legitimität eitel bleibt. Ästhetik und Politik gehören eben doch zusammen, ohne daß die Kunst im billigen Sinn des Worts politisieren, der Staat sich zum Kunstrichter aufspielen müßte. Ohne Poesie kein herrscherliches Charisma. Aus diesem Grund förderte wohl noch ein Lenin Maxim Gorki, ließ er sogar seinem Geschmack fremde Dichter wie Alexander Blok und Wladimir Majakowski wenigstens gewähren. „Ich kann nur den Tod geben“, sagte der König zu Ronsard, „du aber verleihst Unsterblichkeit“.
So sah es auch Schota Rustaweli, der geistesverwandte Freund Thamars, ihr ebenbürtig: „Gleich sind sich des Löwen Junge: sei’n sie männlich oder weiblich.“ Der größte Dichter der Nation hat das Andenken ihrer größten Königin, seiner Muse und allen die Verkörperung des glänzendsten Zeitalters der Geschichte Georgiens, in Versen festgehalten, die erst mit dem letzten Georgier vergehen werden, und vielleicht nicht einmal dann.
Thamar – Tinatin
Thamar lebt weiter in seinem Epos, so wie Beatrice unsterblich wurde durch Dantes Weltgedicht. Thamars Name erklingt, nach den Worten eines Chronisten, dank Schotas Schöpfung „Der Mann im Pantherfell“ ebenso von den Lippen der singenden Pflüger und Hirten wie in den Festhallen der Könige, deren einer, Wachtang VI., im Jahre 1712 – ein halbes Jahrtausend nach dessen Entstehung – die erste Buchdruckausgabe des Werks von Rustaweli mit einem von ihm selbst verfaßten Kommentar erscheinen ließ:
Von jenem Löwen, der glanzvoll
mit dem Speere ficht, mit Schild und Schwert – der Sonnenkönigin Thamar,
Rubin die Wangen und gagatschwarzes Haar – ich weiß nicht, wie ich es wagen kann,
ihren Lobpreis zu singen!
Mir ward geboten, zu ihrem Lobe
süße Verse zu reimen,
ihr Antlitz zu preisen,
die Brauen und Wimpern,
ihr Haar, die Lippen und Zähne, fein gereiht, geschliffener Kristall zwischen Rubinen schimmernd.
Der Liebende sei dem Auge schön
und strahlend wie die Sonne,
Weisheit und Großmut im Reichtum geziemen ihm, Ritterlichkeit und ebenbürtiges Wesen.
Er sei beredt, klug und voller Geduld,
doch siegreich über mächtige Feinde.
Wer keine dieser Gaben hat,
ist für die Kunst der Minne nicht geschaffen.
Liebe ist hold und schön,
in ihrer Art schwer zu ergründen.
Wahre Liebe ist ferne treuloser Lust
und ist ihr nicht zu vergleichen.
Sie ist etwas für sich. Und Buhlen etwas anderes. Tief ist die Kluft dazwischen.
Daß keiner beide vermische!
Hört ihr meine Worte?
Beständig sei der Liebende,
reinen und edlen Herzens, niemals treulos.
Wenn er der Geliebten ferne ist,
werde sein Atem zu Seufzern.
Einer Einzigen nur gehöre sein Herz,
möge ihm daraus auch Herbes und Ungunst erwachsen. Ich verabscheue eine Liebe ohne Herz,
wo nur umarmt und laut geküßt wird …
Der wahrhaft Liebende ist jener,
der eine Welt erträgt …
Die einzig edle Liebe
stellt sich nicht zur Schau, verhüllt ihr Leid.
Der Liebende gedenket ihr allein
und sucht die Einsamkeit …
Niemandem soll er sein Geheimnis
je enthüllen,
nicht jammern auf niedrige Weise
und die Geliebte entehren …
Der Geliebten sei all sein Denken geweiht,
nichts anderes habe er im Sinn,
und wenn er Menschen naht, so ist es besser,
daß seine Liebe er verhülle.
(Aus dem Georgischen übersetzt von Ruth Neukomm.)
„Der Mann im Pantherfell“
Doch dies ist nur der Prolog, und auch dieser hier nur bruchstückhaft wiedergegeben! Der Inhalt des Epos läßt sich kaum referieren, weil er eine ganze Welt enthält. Aber wenigstens das Skelett der Handlung sei skizziert. Aus Liebe zur durch ihren eigenen greisen Vater auf den Thron erhobenen Tinatin – deren Vorbild, ich sagte es schon, die Königin Thamar selbst ist – zieht der Ritter Awtandil durch fast alle Länder Asiens, um Nestan Daredschan, die verlorene Geliebte seines Freunds Tariel, zu suchen.
Durch ein grausames Geschick von ihr getrennt, hat Tariel darüber fast seine Sinne verloren. Awtandil unternimmt seine Fahrt sowohl aus Liebe zu Tinatin als auch aus Freundschaft zu Tariel. Liebe zur Frau und Freundschaft mit einem gleichartigen Mann ergänzen einander; beide sind heilig. Durch viele Gefahren, Umwege und Schwierigkeiten, die manchmal aussichtslos und untergangsschwanger scheinen, gelingt es Awtandil schließlich, der von bösen Geistern entführten Nestan Daredschan auf die Spur zu kommen. Kampf und gewaltsamer Tod, Leidenschaften und Freude am Prunk kommen ebenso ausführlich zur Sprache wie Liebe und Treue, Wunder der Natur und lichtmystische Frömmigkeit.
Wilde Tiere begegnen dem edlen Ritter, er genießt die Gastfreundschaft turnierfreudiger Fürsten, bekommt es mit Piraten und einer lebenslustig-liebeshungrigen Kaufmannsfrau zu tun, stößt auf immer neue Hindernisse, bis es ihm am Schluß gelingt, die getrennten Liebenden zu verbinden und, eben dadurch, die Hand Tinatins zu gewinnen.
Wie dürftig ist ein Abriß dieser Art, eben nur ein dürres Gerippe. Aber „Der Mann im Pantherfell“ ist pulsierendes Leben, das sich auch noch im Angesicht des Tods am Leben erfreut. Es enthält das unscheinbar Kleinste und das Gewaltigste, aber beides beseelt, lebenstrotzend und gleichwohl ins Sinnbildliche erhöht und geistig verklärt. Der Bogen spannt sich von den Schweißtropfen, die dem Gärtner vom Gesicht auf die Brust rinnen, über die üppigen Gelage der Könige und die Pracht ihrer Paläste bis zu Ekstase und Wahnsinn, Schmerz und Entzücken der letztendlich dennoch in Zucht und Maß gründenden Liebe der beiden Paare, die einander wie Sonne, Mond und Sterne begegnen, ja darüber hinaus bis in den Kosmos insgesamt und, sogar diesen noch transzendierend, in die Sphäre des Göttlichen. Es gibt bei Schota Rustaweli Szenen, die von Boccaccio stammen könnten; Schlachtenschilderungen, deren Präzision jeden Strategen zu erregen vermag; märchenhaft schwelgerische Abschnitte, die würdig wären, in den Märchen aus Tausendundeiner Nacht zu stehen; archetypische Konfigurationen, wie sie auch im Gilgamesch-Lied, bei Homer und in Wolframs „Parzival“ vorkommen; immer wiederkehrend aber auch geradezu hieratische Lobpreisungen, eine Liturgie der trotz tödlichen Ernsts doch auch als ein Spiel vor Gott verstandenen Liebe, durchsetzt von Freude an überschwenglichen Juwelenwörtern und litaneigleichen Apostrophen; und daß er überdies ein philosophisch wie theologisch hochgebildeter, in antiker wie christlicher Weisheit bestens bewanderter Mann war, beweisen die ausdrücklichen und, häufiger noch, kunstreich versteckten Nennungen des Pythagoras, Heraklit, Empedokles, Platon, Proklos, Dionysios Areopagita, der Bibel und des Koran.
Schota Rustawelis „Mann im Pantherfell“ ist das Hohelied der Liebe und Freundschaft, der Ritterlichkeit und des Adels des Menschen. Es besingt den Sieg des Lichts über die Finsternis, des Edlen über das Gemeine, des Muts über die Verzweiflung. Wer es liest, und sei es auch nur in einer Übersetzung, wird flugs entrückt in eine Welt des Strahlenden, Sternhaften und Reinen, in der es sich wunderbar atmen läßt und die gleichwohl trotz ihrer heroisch-hohen Helle von ergötzlichster Buntheit und figürlicher Fülle ist.
Das sage ich, der ich kaum drei georgische Worte radebrechend zu sprechen vermag, also die Kenntnis des Werks einzig und allein der Übersetzung von Ruth Neukomm verdanke. Für den Georgier ist es nicht „Klassik“ in jenem fatalen Sinne, den das Wort nachgerade im Deutschen erhalten hat, vielmehr im Sinne Nietzsches, von dem die herrliche Sentenz stammt: „Alles Gute ist Erbschaft.“
Rustaweli und sein Epos sind auch in Sowjetgeorgien nicht Literaturhistorie, Museum, widerspenstig oder gelangweilt übernommenes Pensum, sondern Geist und Leben, Stolz und Entzücken der gesamten Nation. Auch als Georgien 1783 zum Klientelstaat Rußlands und 1801 zur Provinz des Zarenreichs erniedrigt wurde; auch als es seiner – infolge der Revolution wiedererlangten – politischen Selbständigkeit (1918 bis 1921) durch die bolschewistische Konterrevolution abermals beraubt wurde; auch als Moskau zeitweilig sogar die letzte dem Volk verbliebene Habe zu konfiszieren trachtete, die uralte Sprache und Schrift – Schota Rustawelis „Mann im Pantherfell“ konnte bis auf den heutigen Tag keine Gewalt den Herzen der Georgier entreißen. Niemand vermochte im geringsten zu mindern des Volks Liebe, das in königloser Zeit endgültig zum Hüter der Dichtung herangereift war.
Georgien – Spiegelbild Europas
Ein Volk mit einer so tiefgehenden Beziehung zu einem Werk, das vor bald 800 Jahren hervorgebracht wurde und heute noch so frisch ist wie am ersten Tag, kann kein kleines Volk sein, auch wenn es zur Zeit kaum mehr als dreieinhalb Millionen Menschen umfaßt, von denen, anders als die Armenier, die allermeisten im eigenen Land, auf dem Gebiet der Georgischen Sowjetrepublik, leben. Die Größe eines Volks wird ebensowenig von der Anzahl beeinflußt wie die Größe eines Alexander von seiner Körperlänge, die, wie bekannt, unterdurchschnittlich gering war.
Groß ist ein Volk, das einen Dichter dieses Rangs geboren hat. Größer ist ein Volk, das – von König Wachtang VI., der selbst ein Dichter von Rang war, bis zum Handwerker, Winzer und Ochsentreiber – in Niedergang, Niederlage und auch nach Verlust seiner staatlichen Souveränität diesem Dichter die Liebe bewahrt hat.
Schota Rustaweli ist unvergessen. Er hat bis heute Generation auf Generation fortzeugend inspiriert. Er blieb Kompaß und Norm in Zeiten der Bedrängnis und Entmündigung. Er ist der Magnetberg, der bisher alle Versuche nationaler Selbstentfremdung zerschellen ließ.
Was Byron einmal von dem Österreicher Franz Grillparzer sagte, gilt sinngemäß auch für mehr als ein Jahrtausend georgischer Dichtung: Man wird sich diese manchmal für deutsche Ohren ein wenig bizarr klingenden, für deutsche Zungen etwas mühsam auszusprechenden Namen, die so oft auf -schwill („Kind“) oder -dse („Sohn“) enden, endlich merken und einprägen müssen: Ilia Tschawtschawadse, Nikolos Barataschwili, Giorgi Eristawi, Akaki Zereteli, Aleksandre Kasbegi, Wascha Pschawela, Nikolos Lordkipanidse, Grigol Robakidse, Galaktion Tabidse, Paolo Taschwili, Tizian Tabidse, Ana Kalandadse und Giorgi Leonidse, die hier stellvertretend für manche andere aus dem 19. und 20. Jahrhundert genannt sind … Sie alle sind Kinder, Enkel und Erben Schota Rustawelis, des königlichen Dichters in mehr als einem Sinne, des Dichters mit der reifen Hand, die kämpft, schenkt und segnet.
An Schota Rustaweli, den Sänger Thamars, den Schöpfer des Hohelieds opferbereiter Liebe und verschworener Wahlgeschwisterschaft, den von Geschlecht zu Geschlecht getreuen Eckart, an dessen väterlicher Hand die Kinder in ihre dichterische Muttersprache hineingeführt wurden, muß ich immer denken, wenn Georgien genannt wird …
An Georgien muß ich denken, wenn ich wieder einmal der unnachahmlichen Symphonie dieses Meisters hingerissen folge und mich am Wohlklang, Ebenmaß und Duft ihrer alle Bereiche der Welt beschwörenden Worte bis zu Tränen des Glücks rühren lasse.
Groß ist ein Volk, an das man denkt, wenn sein Dichter entzückt. Und welcher Ruhm umspielt einen Dichter, der immer mitgedacht wird, wenn von seinem Volk die Rede ist …
Dank aber auch denjenigen, die uns in geduldig stiller Arbeit das Werk dieses Dichters überhaupt erst zugänglich gemacht und erschlossen haben, insbesondere Ruth Neukomm und – bereits vor hundert Jahren – Arthur Leist, hierbei freudig Schotas eigenes Wort beherzigend und bewahrheitend:
„Nur was du gibst, ist wahrhaft dein, was du behältst, das ist verloren!“
Ehre Schota Rustaweli, dem freigiebig Handreifen Georgiens, dem seit 800 Jahren freiwillig Tribut gezollt wird! Ehre dem Ersten des Lands, bei dessen Ruf sich auch die ihm nachfolgenden Dichter erheben, zu dem sie bei jedem gelingenden Wort aufschauen! Ehre dem Geleiter des Volks, das uns im nächsten Jahrtausend vielleicht mit einem neuen Epos beschenken wird, dessen Meister womöglich bereits geboren ist! Aber auch sein Text wird Entzifferung, Übersetzung und Widerhall des durch die Jahrhunderte tönenden Lieds sein … Ehre der gewaltlosen Macht des Dichters, der Poesie der Muttersprache, dem Vaterland Poesie in Zeiten des Exils, der Freude der Könige und Zuflucht der Völker …
Ehre dem Land des Kaukasiers Prometheus und der Kolcherin Medea, dem Lande Thamars und Schota Rustawelis, das wir Europäer Georgien, die Russen Grusia, die Perser Gurdjistan und die Türken Gurdij nennen, das von seinem bodenständigen und stolzen Volk, den Kharthweli, aber seit eh und je geheißen wird: Sakharthwelo.
Der Artikel von Gerd-Klaus Kaltenbrunner wurde 1989 zum ersten Mal veröffentlicht und im Buch „Vom Geist Europas, Band II“, ARES Verlag 2019 erneut abgedruckt.